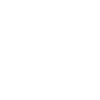technische hochschule deggendorf
innovativ & lebendig
Die Technische Hochschule Deggendorf bietet Ihnen verschiedene Kooperationsmöglichkeiten:
- Finden Sie die Studierenden und Absolventen, die ideal zu Ihrem Unternehmen und Ihren offenen Stellen passen.
- Unterstützen Sie Studierende als Mentor oder Förderer.
- Arbeiten Sie mit der Technischen Hochschule Deggendorf bei Seminaren und Projekten zusammen.
- Profitieren Sie als Kooperationspartner von den Ergebnissen der anwendungsorientierten Forschung einer Technischen Hochschule.
- Nutzen Sie die Räumlichkeiten der Technischen Hochschule Deggendorf für Ihre Events und Veranstaltungen.
Gerne beraten wir Sie individuell. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Werden Sie deshalb noch heute Kooperationspartner des Career Service - wir freuen uns auf Sie!
veranstaltungen
aktuelles

Beste Stimmung herrschte beim ersten Treffen eines vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) finanzierten Projektes zum Aufbau einer strategischen Partnerschaft an der Technischen Hochschule Deggendorf (THD). Eine Delegation der rumänischen Aurel Vlaicu Universität (AVU) aus Arad rund um Rektor Prof. Teodor Florin Cilan besuchte die Deggendorfer Kolleginnen und Kollegen vom 8. bis 11. Februar. Intensive Arbeitsgespräche sowie ein vielfältiges Rahmenprogramm füllten die Tage in Deggendorf.
„Wir sind sehr glücklich, mit der AVU zu einer weiteren renommierten Universität eine intensive Partnerschaft aufzubauen. Diese Verbindungen sind ein echter Gewinn sowohl für die Studierenden als auch das wissenschaftliche Personal auf beiden Seiten“, bekräftigt THD-Präsident Prof. Waldemar Berg. An der Deggendorfer Hochschule sind die drei Fakultäten Angewandte Wirtschaftswissenschaften, European Campus Rottal-Inn und Angewandte Naturwissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen in das Projekt eingebunden. Zudem sind die zentralen Einrichtungen und die Verwaltung beider Partneruniversitäten involviert. Die Beteiligung von Praxispartnern und weiteren externen Institutionen ist in den Zielvorgaben ebenso verankert. Mindestens fünf Kooperationsvorhaben wollen die neuen Partner in praxisorientierter Lehre, Forschung und Transfer festlegen. In ersten gemeinsamen Runden wurden Besprechungen zu konkreten Vorhaben geführt. Diese sind im Bereich Tourismus, an der THD vertreten durch Prof. Dr. Marcus Herntrei, im Bereich Management unter Leitung von Prof. Dr. Jürgen Sikorski und im Bereich Sport, vertreten durch THD-Professor Dr. Richard Latzel, vorgesehen. Nach drei intensiven Tagen des Austausches verabschiedete sich die rumänische Delegation und freut sich auf das nächste Arbeitstreffen, das in Arad im März 2026 stattfinden wird.

Der Rettungsdienst im gesamten deutschsprachigen Raum ist mehr denn je im Wandel, um den steigenden Herausforderungen im Berufsalltag gerecht zu werden. Ende vergangener Woche lud die Technische Hochschule Deggendorf (THD) deshalb zu einem Workshop zur akademischen Ausbildung in der außerklinischen Akut- und Notfallversorgung für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter ein. Daran beteiligten sich routinierte Akteure sowie hochschulische Expertinnen und Experten im präventiven Rettungsdienst aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie tauschten sich über ihre Erfahrungen im aktiven Dienst, in der Aus- und Weiterbildung von Rettungsfachpersonal sowie in der Verbandsarbeit aus, um die Grundlage für einen möglichst flächendeckend einheitlichen Basislehrplan für die Teilakademisierung in der außerklinischen Akut- und Notfallversorgung zu schaffen.
Erfolgreicher Diskurs für ein weitgehend einheitliches Curriculum
Während der eine Teil der Expertinnen und Experten die Rolle von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern (NotSans) in Forschung und Entwicklung sowie die Einbettung wissenschaftlicher Fertigkeiten in die akademische Ausbildung diskutierte, arbeitete eine zweite Gruppe an der Verankerung fachlicher Kompetenzen und sozialer Skills zur erweiterten Patientenversorgung im Curriculum. Im Fokus des gemeinsamen Vorhabens stehen die akademische Qualifizierung von NotSans im präventiven Rettungsdienst sowie die Befähigung zur eigenverantwortlichen, fallabschließenden Bearbeitung niedrigprioritärer Einsätze. In den kommenden Monaten stehen die Entwicklung und die Ausformulierung des gemeinsamen Basislehrplans an. Der federführend aktive THD-Professor Dr. Dr. med. habil. Mathias Burgmaier fasst es treffend zusammen: „Auch wenn wir zusammen mit unseren Praxispartnern vom Bayerischen Roten Kreuz und weiteren Akteuren im Feld ein großartiges Curriculum für ein Studium an der THD entwickelt haben, wird es im Gesundheitssystem zukünftig keine Insellösung für Deggendorf geben. Dauerhaft erfolgreich werden wir nur gemeinsam sein – wenn wir es schaffen, ein einheitliches Curriculum national zu denken. Hierzu müssen wir jetzt proaktiv und gemeinsam vorangehen.“ Sebastian Lange von der Landesgeschäftsstelle des Bayerischen Roten Kreuzes verdeutlichte: „Die Schritte, die wir in Bayern mit der außerklinischen Versorgung im Rettungsdienst gehen, haben Leuchtturmfunktion weit über die Grenzen Bayerns hinaus."
Vorgespräche bereits im Herbst 2025
Dem von der THD-Arbeitsgruppe Präventiver Rettungsdienst initiierten Workshop ist bereits Ende Oktober 2025 eine Expertenrunde, organisiert von der Bayerisches Rotes Kreuz – Regensburger Rot-Kreuz-Stiftung, vorangegangen. Dabei wurde eruiert, wie vorbeugender Rettungsdienst den Anforderungen der Zukunft begegnen kann. Die Folge waren Rufe nach einer bundeseinheitlichen akademischen Aus- / Weiterbildung in der außerklinischen Akut- und Notfallversorgung (ANV) für NotSans, auf die die THD nun mit dem auf den DACH-Raum ausgeweiteten Workshop reagierte.
Erfahrungen aus der regionalen Praxis: Entlastung des bestehenden Rettungssystems
Zu Beginn berichtete der erfahrene Notfallsanitäter Andreas Bauer, der zugleich an der THD in der ersten Kohorte Außerklinische Akut- und Notfallversorgung (ANV) studiert, über seine Erfahrungen mit dem Rettungseinsatzfahrzeug (REF). Dies war zunächst als Pilotprojekt in Regensburg gestartet worden und wurde mittlerweile im erweiterten Probebetrieb an weiteren Standorten in Bayern etabliert. Die bisherigen Erfolge sprechen für sich: NotSans, die über eine Zusatzausbildung erweiterte Kompetenzen zur Diagnostik und medizinischen Ersteinschätzung haben, können akut, aber nicht lebensbedrohlich leidende Patientinnen und Patienten fallabschließend zuhause behandeln, an geeignete fachliche Versorgungsdienstleistende oder unter Umständen auch andere niedrigschwellige Hilfsangebote vermitteln. Bei Bedarf organisieren sie geeignete Transportlösungen. Typische Szenarien hierfür sind zum Beispiel sozial indizierte Einsätze wie soziale Hilflosigkeit zu Hause und im öffentlichen Raum, Stürze in Altenheimen, Dehydration oder palliative Patientenbetreuung außerhalb üblicher Dienstzeiten. So bleiben die für lebensrettende Einsätze und Patiententransporte ausgestatteten Rettungswägen für dringende Notfälle verfügbar und gleichzeitig werden Notaufnahmen durch das Abfedern von akuten Behandlungsbedarfen bei Bagatellverletzungen oder chronischen Erkrankungen nicht überlastet. Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Erfahrenen NotSans, die sich weiterbilden und gleichzeitig in der Patientenversorgung bleiben wollen, werden an den Hochschulen neue berufliche Perspektiven geöffnet. Die erste Hochschule mit einem solchen Angebot in Bayern war die THD mit dem Bachelorstudiengang „Außerklinische Akut- und Notfallversorgung". Dieser wurde von Studiengangsleiter Prof. Dr. Dr. Mathias Burgmaier in enger Zusammenarbeit mit der Landesgeschäftsstelle des Bayerischen Roten Kreuzes und weiteren Akteuren entwickelt.
Kanadisches Vorbild
Nach der ersten Workshoprunde wurde Michael Nolan für einen Impulsvortrag zugeschaltet. Der Kanadier gilt international als Pionier im Feld der Akut- und Notfallversorgung und ermutigte die Workshopteilnehmenden zu ihrem besonderen Engagement für den Rettungsdienst. In seiner über 30-jährigen beruflichen Laufbahn konnte er unter anderem die Einführung von Community Paramedics als zentrale Akteure in den Gesundheitssystemen im angloamerikanischen Raum gestalten. „Ihr Wirken ist mehr als nur die reine Reaktion auf den Notruf“, erläutert der „Vater der Community Paramedics“, wie ihn Mathias Burgmaier nennt.
Diese Vision von einer modernen, präventiven Notfallversorgung – mit dem in Deggendorf gestarteten Studiengang – hat Potential, in Deutschland, Österreich und in der Schweiz langfristig die Patientenversorgung im Bereich niedrigprioritärer Einsätze zu verbessern und gleichsam Kostensteigerungen Einhalt zu bieten.

Klimawandel und Energiewende: Allgegenwärtige Herausforderungen, die uns alle in Zukunft immer mehr beschäftigen werden. Wie lässt sich dieses Thema im Unterricht aktiv angehen und darstellen? Dazu bietet die Technische Hochschule Deggendorf (THD) in Zusammenarbeit mit der Initiative Junge Forscherinnen und Forscher e.V. (IJF) eine Lehrkräftefortbildung. Die Veranstaltung findet am 24. März von 9 bis 17 Uhr am Campus in Deggendorf statt. Anmeldeschluss ist der 13. März.
Ein Modellhaus dient als Beispiel und Anwendungsobjekt: Wie funktioniert Dämmung, was leisten erneuerbare Energien, welche können wo zum Einsatz kommen und welche Möglichkeiten gibt es im Bereich der Elektronik? Das Organisationsteam bietet im Rahmen der Lehrkräftefortbildung einen umfassenden Einblick in die Themen erneuerbare Energien und Klimawandel sowie Nachhaltigkeitsaspekte und Energieeffizienz. Dabei werden zahlreiche Möglichkeiten gezeigt, diese Aspekte im Unterricht anwendungsorientiert zu behandeln. Projektorientiertes Arbeiten steht dabei grundsätzlich im Mittelpunkt.
Nach der Mittagspause hält THD-Professor Dr. Bernd Kuhn einen Vortrag zur Bedeutung von Wasserstofftechnologien in der Energiewende. Anschließend begeben sich die Lehrkräfte mit Prof. Dr. Roland Zink auf eine Exkursion zu verschiedenen Standorten erneuerbarer Energien in der Umgebung Deggendorfs.
Die Fortbildung richtet sich an Fachlehrkräfte der weiterführenden Schularten und eignet sich für alle naturwissenschaftlichen und technischen Schulfächer sowie Angebote der Berufsorientierung. Eine Anmeldung ist über das FIBS-Anmeldeportal möglich, Kursnummer E841-0/26/425214. Weitere Informationen unter www.th-deg.de/veranstaltungen.